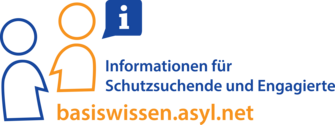Inhalt:
- Regelung und Begriffe
- In der Praxis
- Materialien
1. Regelung und Begriffe
Geflüchtete Menschen dürfen nicht immer frei entscheiden, wo sie wohnen wollen. Je nachdem, wie ihr rechtlicher Status ist, können Behörden bestimmen, wo sie wohnen müssen. Das nennt man „Wohnsitzauflage“ oder „Wohnsitzregelung“. Wer im Asylverfahren ist (also eine Aufenthaltsgestattung hat) oder wer über eine Duldung verfügt, unterliegt unter Umständen einer Residenzpflicht und/oder einer Wohnsitzauflage. Eine Residenzpflicht bedeutet, dass die Betroffenen einen bestimmten Ort (zum Beispiel eine Stadt oder einen Landkreis) nicht bzw. nur mit behördlicher Genehmigung verlassen dürfen. Die Wohnsitzauflage legt für die Betroffenen einen bestimmten Wohnort oder auch eine konkrete Wohnung bzw. Unterkunft fest und verbietet Umzüge.
Menschen mit einer humanitären Aufenthaltserlaubnis können unter eine Wohnsitzregelung fallen. Die Wohnsitzregelung legt in der Regel ein bestimmtes Bundesland als Wohnort fest.
2. In der Praxis
Menschen, die in Deutschland einen Asylantrag stellen, werden zunächst in einer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht. Sie sind grundsätzlich verpflichtet, dort bis Abschluss ihres Asylverfahrens wohnen zu bleiben, maximal jedoch bis zu 18 Monate. Die einzelnen Bundesländer können sogar einen noch längeren Zeitraum bestimmen – bis zu 24 Monate. Somit hängt die zulässige Verpflichtungsdauer auch vom Bundesland des Wohnortes ab. Familien mit Kindern dürfen dagegen nur bis zu sechs Monate verpflichtet werden, in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen.
Für Schutzsuchende aus „sicheren Herkunftsländern“ gilt die Verpflichtung zum Leben in einer Erstaufnahmeeinrichtung bis zum Ende des Asylverfahrens bzw. unter Umständen sogar bis zur Ausreise. Auch hier gilt allerdings wieder die Ausnahme für Familien mit minderjährigen Kindern. Diese dürfen für maximal sechs Monate zur Wohnsitznahme in der Erstaufnahme verpflichtet werden.
Solange Menschen der Wohnpflicht in der Erstaufnahmeeinrichtung unterliegen, gilt für sie zugleich eine Residenzpflicht.
Nach Ablauf der Verpflichtung, in der Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen, erfolgt eine Zuweisung in eine Kommune innerhalb des Bundeslandes - und dort oft in eine sogenannte Gemeinschaftsunterkunft. Dabei kann eine Wohnsitzauflage verhängt werden. Diese schränkt nicht die räumliche Bewegungsfreiheit an sich ein, sondern das Recht, an einem anderen als dem zugewiesenen Ort seinen Wohnsitz zu nehmen. Diese Wohnsitzauflage wird in der Aufenthaltsgestattung vermerkt. Wenn der Lebensunterhalt der Person gesichert ist, oder wenn gewichtige humanitäre Gründe (wie die Wahrung der Familieneinheit) es erfordern, kann eine Wohnsitzauflage aufgehoben bzw. abgeändert werden.
Die Regeln für Personen mit einer Duldung sind sehr ähnlich. Auch sie unterliegen einer Wohnsitzauflage, wenn sie ihren Lebensunterhalt nicht selbst gesichert haben. Darüber hinaus ist eine Wohnsitzauflage als mögliche Sanktion bei Verstößen gegen gesetzliche Mitwirkungspflichten vorgesehen.
Wenn Menschen einen Schutzstatus haben, sind sie zunächst verpflichtet, in einem bestimmten Bundesland (oder einer Kommune) zu wohnen (Wohnsitzregelung). Bei einer Arbeitsaufnahme oder im Falle einer Ausbildung oder eines Studiums soll diese Wohnsitzregelung entfallen.
3. Materialien
Mehr Informationen zu den verschiedenen Wohnsitzauflagen und zu den Möglichkeiten, diese aufheben oder abändern zu lassen, finden Sie in verschiedenen Arbeitshilfe. Die Handreichung des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg enthält dabei teilweise Baden-Württemberg-spezifische Angaben bezüglich Behördenzuständigkeiten, aber die meisten Informationen sind bundesweit gültig.
→ Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, Wohnsitzauflagen im Migrationsrecht, Dezember 2019
→ IvAF-Netzwerk BLEIBdran, Residenzpflicht. Wohnsitzauflage. Wohnsitzregelung, Mai 2020